
Conference Debriefing (41): 50 Jahre Monopolkommission
PDF-Version: Hier klicken
Zitiervorschlag: Steinert, DKartJ 2024, 19-24
Die Monopolkommission hat Geburtstag! Schon seit 50 Jahren ist sie das unabhängige Beratungsgremium der Bundesregierung. In Berlin kam die deutsche Wettbewerbscommunity zusammen, um sie zu feiern. Und wie könnte man die “Verfechterin des Wettbewerbs” besser feiern als mit dem, was sie ausmacht: Intensive Debatten und “kritischer Diskurs”. Als Geburtstagsgeschenke gab es leider keine Umsetzungsversprechen aus der Politik, aber dafür hochrangige Anerkennung und überraschenden Bekenntnisse. Sebastian Steinert berichtet.
Name der Veranstaltung: 50 Jahre Monopolkommission – Wettbewerb im Spannungsfeld von Industriepolitik und ökologischer Transformation
Ort & Zeit: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Berlin, 05.06.2024
Gastgeber: BMWK und Monopolkommission – in der sitzen derzeit die beiden Professoren Jürgen Kühling und Tomaso Duso sowie aus der Unternehmenspraxis Dagmar Kollmann, Pamela Knapp und Constanze Buchheim.
Publikum: Alle, die mit der Monopolkommission gelegentlich zu tun haben: Bundestagsabgeordnete wie Sandra Detzer, Kartellbeamte wie Eva-Maria Schulze (BKartA) und Thomas Deisenhofer (EU-KOM), Richter wie Jan Tolkmitt (BGH) und Ulrich Egger (OLG Düsseldorf), die Anwaltschaft (Düsseldorf natürlich wieder stark vertreten), Profs (z.B. Thomas Weck oder Gabriela von Wallenberg, die selbst mal für die MoKo gearbeitet haben) und natürlich VertreterInnen von Monopolisten (Thoralf Schwanitz von Google), solchen, die es gern blieben (Wolfgang Kopf von der Telekom), und solchen, die gegen eben diese kämpfen (Peter Westenberger vom Verband Die Güterbahnen).
Für die Jubiläumsfeier wurde ein straffes Programm vorbereitet: Eine Keynote, zwei Vorträge und sechs Diskussionen. Und das alles in unter fünf Stunden (Spoiler: Es hat länger gedauert). Dieses Conference Debriefing können Sie also entweder lesen, wenn Sie an der Zukunft des deutschen Wettbewerbsrechts interessiert sind oder aber wenn Sie noch Inspiration für die Feier Ihres nächsten runden Geburtstags suchen.

1. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
Eine Testfrage zu Beginn: Was ist reizvoller, die Arbeit in der Monopolkommission oder die im Rat der „Wirtschaftsweisen“? Carl Christian von Weizsäcker, dem beide Mitgliedschaften angeboten wurden, gab per schriftlichem Grußwort eine klare Antwort: Er entschied sich für die MoKo, weil die Zusammenarbeit mit den Praktikern so reizvoll sei (Geburtstagskompliment Nr. 1 des Tages). Denn die MoKo zählt klassischerweise drei VertreterInnen aus der Wirtschaftspraxis zu ihren Mitgliedern. Das sind aktuell:
- Dagmar Kollmann (seit 2012), u.a. Aufsichtsrätin bei der Deutschen Telekom und beim Bankkonzern CitiGroup Global Markets Europe,
- Pamela Knapp (seit 2020), u.a. Aufsichtsrätin beim Lichttechnikhersteller Signify und beim Chemiekonzerm Lanxess, und
- Constanze Buchheim (seit 2022), u.a. Aufsichtsrätin beim Softwareunternehmen Valsight und Präsidentin der Entrepreneurs’ Organisation Berlin.

Im ersten Panel, einem kurzweiligen Gespräch mit den beiden Wissenschaftlern Jürgen Kühling (Recht) und Tomaso Duso (Wirtschaft), durften die drei von ihren Highlights aus den vergangenen Jahren in der MoKo erzählen. Für Dagmar Kollmann war es die Zeit nach der Finanzkrise und die intensive Auseinandersetzung mit dem 3-Säulenmodell der deutschen Bankenlandschaft. Pamela Knapp war selber einmal Vorständin eines Unternehmens, dem eine Kartellgeldbuße auferlegt wurde (natürlich vor ihrer Zeit!). Sie hat sich deshalb besonders an der Diskussion zur Haftung von Vorstandsmitgliedern beteiligt (ist Thema im nächsten Hauptgutachten, das am 1. Juli übergeben wird). Constanze Buchheim ist im Startup- und Digitalbereich zuhause, und deshalb standen für sie die Diskussionen zu agiler Unternehmensführung und zu Geschäftsmodellen mit Künstlicher Intelligenz im Vordergrund. Die Unternehmerinnen machten deutlich, dass es einen wichtigen Unterschied machen kann, wenn die Perspektive der Unternehmen eingebracht wird. Das ist dann wohl der berühmte Unterschied zwischen Theorie und Praxis, der für von Weizsäcker entscheidend war.
2. Die Betrachtung des Olymp
Wer noch nicht ganz weiß, wo die Monopolkommission im deutschen Institutionengefüge einzuordnen ist, dem sei erklärt: Die Monopolkommission ist der deutsche Olymp für Wettbewerbsfragen.
Ein besonders großes Geschenk
So sagte es zumindest Professorin Veronika Grimm, ihres Zeichens Mitglied bei der großen Schwester, den Wirtschaftsweisen, pardon dem „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“. Sie berichtete, wie sie sich als VWL-Studentin 1995 für Wettbewerbsthemen begeisterte und auf die Monopolkommission als den “Olymp” blickte. Ein größeres Geburtstagskompliment hätte sie zum Jubiläum wohl kaum mitbringen können. Sie setzte aber noch einen drauf und lobte die Gutachten der Monopolkommission als “hochrelevant” und “auf den Punkt”. Die EntscheiderInnen im Raum mahnte sie, die Empfehlungen der Monopolkommission zu befolgen, denn der Wettbewerb sei das Asset, das uns den entscheidenden Vorteil gegenüber Autokratien verschafft.
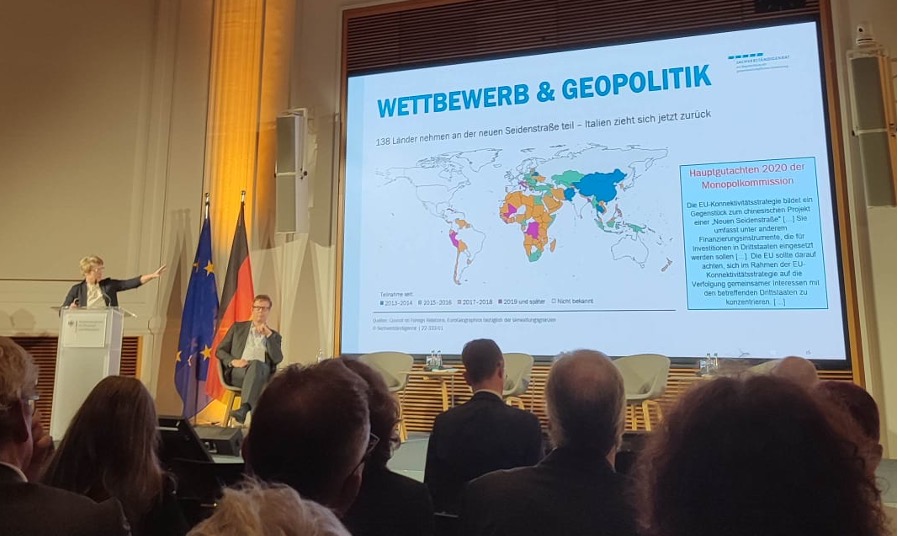
Für den Wettbewerb gibt es immer Luft nach oben
In ihrem Vortrag “Wettbewerb in der Klimapolitik: Zwischen politischen Zielen und wettbewerblichen Instrumenten“ hielt sie dann ein fundiertes Plädoyer für mehr Wettbewerb in der Klima- und Energiepolitik.
Was es dafür braucht? Vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, um Unternehmen Investitionssicherheit zu bieten (auch für die berüchtigten Brennstoffzellen, über die sich Grimm zuletzt mit den anderen Wirtschaftsweisen zerstritten hatte). Außerdem brauche es einen klaren Fokus auf den Emmissionshandel statt eines Blumenstraußes an verschiedenen Handlungsinstrumenten, die sich gegenseitig der Anreizwirkung berauben (das war wohl das einzige Mal an diesem Tag, dass in einer Sache weniger statt mehr Wettbewerb gefordert wurde). Aber auch vor der geopolitischen Dimension schreckte die Wirtschaftsweise nicht zurück: Europa müsse an der Einrichtung eines Weltmarktes für grüne Energie arbeiten und deshalb sollte für den zukünftigen Energiehandel „die werteorientierte Außenhandelspolitik nicht an erster Stelle stehen“. (Man sagt, das Echo des Raunens im Saal halle immer noch nach).
Legacy und Lanz
Nach dem Vortrag kam mit den Worten von Jürgen Kühling die “Legacy” der Monopolkommission zum Zuge, denn Justus Haucap, Kommissionsvorsitzender 2008-2012, ergriff das Wort. Er erinnerte sich, wie das Sektorgutachten Gas und Strom 2009 einen regelrechten „Shitstorm“ auslöste (hieß das damals schon so?), weil es die Idee aufbrachte, auch im Markt für erneuerbare Energien Wettbewerb einzuführen. Er lobte Grimm als Stimme im Sachverständigenrat – und bei Markus Lanz –, die den Wettbewerb hochhält. Jürgen Kühling animierte das zu einer Ermahnung aller Kollegen, es ebenso zu halten: “Erst forschen, dann twittern und dann ab zu Lanz. Und nicht erst zu Lanz und dann überlegen, ob man dazu etwas forschen kann.”
3. Der wertegebundene Wettbewerb
Der nächste Redner wurde mit Spannung erwartet, denn es hatte sich dank FAZ schon herumgesprochen: Die Monopolkommission hat bald ein neues Mitglied. Professor Rupprecht Podszun (schon mal gehört?) wird ab 1. Juli die Nachfolge von Professor Jürgen Kühling als Rechtswissenschaftler in der Kommission antreten.
Vorstellung sinnlos
Rupprecht Podszun ist hauptberuflich Blogger (D’Kart) und Podcaster (Bei Anruf Wettbewerb) und nebenberuflich ein “sehr, sehr renommierter Kartellrechtler” (Jürgen Kühling), was seine Vorstellung zu einer “sinnlosen Aufgabe” macht (Moderator Daniel Zimmer, Vorsitzender der Kommission 2012-2016). Zimmer erwähnte nach einigem Lob, das dem Redner sichtlich unangenehm war, dass Podszun in der Vergangenheit nicht nur als Kartellbeamter gearbeitet hatte, sondern auch als Theaterkritiker. Podszun eröffnete seinen Vortrag dann mit den Worten “Wenn ich es jetzt richtig versemmel, kann ich vielleicht wieder als Theaterkritiker arbeiten.”

Kartellrecht war nie unpolitisch
Dem Newbie in der Kommission hatten die Organisatoren ein sehr grundsätzliches Vortragsthema aufgetragen: “Wie politisch darf das Kartellrecht sein?”. Die Themenformulierung gab damit vor, dass das Kartellrecht politisch ist. Und auch Podszun meint, der Glauben an ein unpolitisches Kartellrecht sei eine “groteske Selbsttäuschung”. Politische Entscheidungen und “normative Wertungen” (so Podszuns Synonymvorschlag für alle, denen “politisch” ein zu schmutziger Begriff ist) haben das Kartellrecht immer geprägt. Das zeige sich insbesondere an der Ministererlaubnis, der Fallaufgreifpraxis der Kartellbehörden, der wettbewerblichen Schadenstheorie und den Ausnahmen vom Verbot der Wettbewerbsbeschränkungen. Für die Ministererlaubnis stellte Podszun klar, er hoffe, dass sie noch mit der kommenden GWB-Novelle abgeschafft werde (dieser Satz war die Einladung an alle kommenden Rednerinnen und Redner, ihre Auffassung zur Ministererlaubnis kundzutun).
Wertgebundener Wettbewerb
Wo es Spielräume für Wertungen im Kartellrecht gibt, erwartet Podszun, dass diese so ausgefüllt werden, dass die drängendsten Probleme in der Wirtschaft angegangen werden. Das Kartellamt forderte er ziemlich unverblümt auf, mal wieder so innovativ zu werden wie im Facebook-Fall – aber diesmal mit Umwelt-, statt Datenschutz. Um die Kartellrechtsanwendung nicht zum Allheilmittel zu machen, schlug er das „Leitbild des wertgebundenen Wettbewerbs“ vor: Nach diesem Konzept muss das Kartellrecht wirtschaftliche Macht so einhegen, dass den Grundrechten und der verfassungsmäßigen Ordnung in der Marktwirtschaft zum Durchbruch verholfen wird. Podszun berief sich auf die Gesetzesbegründung, mit der vor 50 Jahren Fusionskontrolle und Monopolkommission eingeführt wurden. Darin steht: es gelte, die “Freiheit anderer” zu sichern. Das ist schon ein anderer Akzent als der Schutz der consumer welfare.
Und was waren die Reaktionen?
Nach Podszuns Vortrag meinte Achim Wambach (Vorsitzender der Monopolkommission 2016-2020), er würde bei den künftigen Diskussionen in der Kommission „ja gern mal Mäuschen spielen“. Einige Redner warnten, man möge doch bitte den Aufgabenbereich des Kartellrechts nicht überspannen. Doch Podszun gab Entwarnung: Das entscheidende Kriterium sei immer der Wettbewerb. Nur hätten sich – siehe Facebook-Fall – die Wettbewerbsparameter geändert. Das war auf jeden Fall ordentlich food for thought – und daher war es gut, dass die Kaffeepause winkte.
4. Der kritische Diskurs
Wie politisch Fragen des Wettbewerbs tatsächlich sind, zeigte das nächste Panel mit dem Titel “Digitalisierung und industrieller Wandel: Wettbewerbspolitik im Rahmen der Transformation”. Das Gespräch wurde zum Beispiel für das, was die MoKo immer anzustoßen versucht: Einen kritischen Diskurs. Moderiert wurde das Ganze von Tomaso Duso (er wird Jürgen Kühling als Vorsitzender folgen). Die Zusammenstellung der Diskutanten versprach von vornherein Stimmung:
- Sven Giegold (Staatssekretär im BMWK, ehem. MdEP für Bündnis 90/Die Grünen),
- Joe Kaeser (ehem. Siemens-Vorstandsvorsitzender und heute Aufsichtsratschef von Siemens Energy und Daimler Truck),
- Ulrike Herrmann (taz, Autorin von „Das Ende des Kapitalismus“) und
- Achim Wambach (ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung).

Das EEG als Glaubensfrage
Joe Kaeser eröffnete mit der Fundamentalkritik, dass die Transformationen aktuell mit viel zu viel Staat und viel zu wenig Markt ausgestaltet werden. Sven Giegold entgegnete, er habe noch nie an die “plumpe Entgegensetzung” von Staat und Markt geglaubt. Er kenne kaum ein Land, in dem die Frage, wie viel der Staat in einer Situation des Wandels eingreifen darf, so “religiös diskutiert” werde wie in Deutschland. Als Erfolgsbeispiel für staatliche Gestaltung nannte er das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und entflammte damit die Zündschnur der Diskussion. Kaeser und Wambach reagierten prompt: Der Erfolg des EEG sei ein Märchen, es habe Innovationen verhindert (Kaeser), die Industrie sei abgewandert (Wambach). Bei Giegolds Optimismus, dass das EEG grüne Technologien erfolgreich machen wird, verwechsele er BWL und VWL, so Herrmann, und für wirksamen Klimaschutz müsse man sich vom Kapitalismus ganz verabschieden. Das einzige was jetzt noch helfe, sei “grünes Schrumpfen”. Ganz im Gegenteil, meinte Wambach, denn “Schrumpfen ist kein Erfolgsmodell”, das andere Länder kopieren würden, um auf dem Weg der CO2-Einsparungen mitzugehen.
Fehlende Unterhaltung konnte man dieser Geburtstagsparty auf jeden Fall nicht vorwerfen.
Vor lauter EEG-Diskussion kam die Digitalisierung (immerhin erstes Wort im Titel des Panels) dann allerdings etwas kurz (Giegold: “Ich werde keine weitere Frage akzeptieren, bis ich hierzu [der EEG-Kritik] Stellung genommen habe”). Aber immerhin konnten alle zum Schluss nochmal die Wichtigkeit der Digitalisierung in einem Satz betonen. Bis auf Ulrike Herrmann natürlich, denn für sie führt die energieintensive Digitalisierung nur “zu KI, die keiner braucht”.
Wünsche zum Geburtstag
Achim Wambach äußerte zum Geburtstag der Monopolkommission noch einen Wunsch: Die Monopolkommission sollte ein Gutachten mit Leitplanken für Beihilfen auf den Weg bringen. Und zwar unter besonderer Beachtung der Punkte Wettbewerb und Innovation. Und auch Sven Giegold adressierte noch einen wichtigen Wunsch an die anwesende “Kirche des Wettbewerbs”. Er sorge sich sehr um den Stellenwert des Wettbewerbs in der EU und warnte vor Erleichterungen in der Fusionskontrolle zur Schaffung von European Champions. Deshalb “müssen wir alle gemeinsam aufpassen, dass nicht zerschlagen wird, was wir über viele Jahre aufgebaut haben.” Denn die gewünschte verbesserte Wettbewerbsfähigkeit Europas werde jedenfalls nicht durch Einschränkungen des Wettbewers erreicht. Ob sein Sitznachbar Joe Kaeser, der Siemens-Chef gewesen war, als die EU-Kommission die Fusion von Siemens und Alstom untersagt hatte, das so unterschreiben würde?
5. Das Wort der Entscheider
Die Monopolkommission berät die Bundesregierung, “entscheiden kann sie aber nichts”, wie die Süddeutsche Zeitung unlängst feststellte. Dafür holte Jürgen Kühling die echten Entscheider nun aufs Podium: Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, und Konrad Ost, Vizepräsident des Bundeskartellamts, der für den kurzfristig verhinderten Andreas Mundt eingesprungen war.

Adams Apfel
Und was sagen die Entscheider zu den viel diskutieren Tendenzen zu einer stärkeren “Industriepolitik” (das ist das euphemistische Codewort für Einschränkungen des Wettbewerbs)? Klaus Müller verglich sie mit dem biblischen Apfel, der Adam verführte: Die Versuchung nach European Champions ist da, aber die Bundesregierung muss stark bleiben. Auch für Konrad Ost stand fest, dass das Bundeskartellamt die Forderung nach Großunternehmen unter Inkaufnahme der Verringerung wettbewerblicher Wirkungen nicht gut finden kann. Er gestand der Politik allerdings zu, dass Wettbewerb nur eines von mehreren Politikzielen ist.
Sneak-Peak
Jürgen Kühling gab im Gespräch eine Vorschau auf Aspekte, die im kommenden Hauptgutachten der Monopolkommission angesprochen werden. Namentlich die Versorgungssicherheit, der Fernwärmemarkt und die Eisenbahnregulierung. Der Machtmissbrauch von Fernwärmeversorgern ist auch Konrad Ost ein Dorn im Auge, und er berichtete, dass das Bundeskartellhamt hierzu mehrere Verfahren führt. Den Eisenbahnmarkt bezeichnete Kühling als den Sektor, bei dem “wir am wenigsten vorangekommen sind”. Das provozierte bei Justus Haucap die Rückfrage, welche Fortschritte Jürgen Kühling denn im Postsektor sehe. Kühling blieb dabei, dass die Bahn den Wettstreit der Incumbents um den letzten Platz gewonnen habe – bei ihr sei die Kundenunzufriedenheit um ein Vielfaches höher als bei der Post. Klaus Müller wies darauf hin, dass es im Postbereich wenigstens zum ersten Mal die Ablehnung eines Portoerhöhungsantrags der Post AG gab.
Die Zukunft des Datenzugangs
Der Deutschen Bahn wurde letztes Jahr ja erst vom Bundeskartellamt verordnet, Wettbewerbern besseren Zugang zu ihren Verkehrsdaten zu gewähren. Auf dieses Thema Datenzugang freuen sich Konrad Ost und Klaus Müller in Zukunft besonders: Die neue europäische Digitalgesetzgebung und das Kartellrecht böten hier reichlich Ansätze für verbesserte Bedingungen. Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur haben mit vier anderen Bundesbehörden bereits das “Digital Cluster Bonn” gegründet, um im Bereich der Digitalregulierung stärker zusammenzuarbeiten. Das schließt § 19a GWB ein. Ost: Es habe sich bereits jetzt gezeigt, dass der DMA mit seinen spezifischen Verpflichtungen schnell an seine Grenzen stoßen kann und deshalb flexible Normen wie der § 19a GWB weiterhin entscheidend sein werden.
6. Die Gratulation von ganz oben
Der Mächtigste zum Schluss: Nachdem er den Messerundgang bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung und eine Rede beim Tag der Bauwirtschaft hinter sich gebracht hatte und bevor er ins Bundeskanzleramt weitermusste, durfte Vizekanzler Robert Habeck endlich sein eigentliches Tageshighlight absolvieren: Seinen Auftritt bei der Party der Monopolkommission. Er war gekommen, so eröffnete er, um ein Geburtstagsständchen zu singen, aus dem dann leider doch eine Keynote wurde. Die war allerdings eine Lobeshymne, also wenigstens ein gesprochenes Ständchen.

Für Robert Habeck ist die Monopolkommission der “Suchscheinwerfer” für wettbewerbliche Herausforderungen im wirtschaftlichen System. Sie sei ein politischer Akteur, aber könne sich auf die Fragen des Wettbwerbs fokussieren. Die Politik kümmere sich dann schon um die anderen politischen Erwägungen.
Der Minister und KI
Im Talk mit Kühling und Monopolkommissarin Constanze Buchheim schaltete Habeck souverän von Luftfahrt und Bauwirtschaft zu Wettbewerbsthemen um. Ganz im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit machte er klar, dass er gerne führende KI-Unternehmen in Deutschland haben möchte, bevor er wettbewerbliche Bedenken hege. Er lasse sich auch gerne von der Monopolkommission für diese Haltung “dissen”. Kann es sein, dass in fünf Jahren ein deutsches KI-Unternehmen zu viel Marktmacht hat? “Ich hoffe es”, so Robert Habeck. Dafür müssten wir uns lösen von der Datensparsamkeit und bräuchten eine “Datennutzungsorgie” – es wäre interessant zu hören gewesen, wie Habecks engagiertes Plädoyer für Pragmatismus im Datenschutz bei seinen ParteifreundInnen ankommt. Bleibt zu hoffen, dass Sven Giegold nach der Geburtstagsparty seinem Chef nochmal seine Warnung in Erinnerung ruft: Wettbewerbsfähigkeit wird nicht durch die Einschränkung von Wettbewerb erreicht.
Hoffnungsvoller Dank
Und damit bildete der Austausch mit Robert Habeck den fulminanten Abschluss einer debattenfreudigen Geburtstagsfeier (Drinks gab’s danach natürlich schon noch). Jürgen Kühling dankte den Gastgebern vom BMWK, in dem das Team von Referatsleiterin Dr. Karolina Lyczywek die MoKo betreut, und dem Team seiner Geschäftsstelle mit Generalsekretär Dr. Marc Bataille und Geschäftsführerin Dr. Juliane Scholl.
Es bleibt die Hoffnung, dass die Monopolkommission auch in Zukunft der Suchscheinwerfer für den Wettbewerb in Deutschland bleibt und ihre “kritische Expertise” (Habeck) in der Politik Gehör findet. Auch wenn das manchmal etwas dauern kann. Oder um es mit den Worten von Achim Wambach zur Fernbus-Liberalisierung zu sagen: “1988 gefordert und zack, schon 22 Jahre später ist es Realität.”

Sebastian Steinert, Maître en Droit, LL.M., schreibt derzeit eine Doktorarbeit zum Digital Markets Act. Die Arbeit wird von Prof. Dr. Rupprecht Podszun betreut.
Ein Gedanke zu „Conference Debriefing (41): 50 Jahre Monopolkommission“
Herzlichen Dank für den schönen Bericht! 🙂